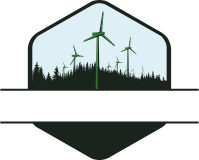PV-Bench: Solarmodule auf dem Mont-Soleil unter die Lupe genommen

Das Pilotprojekt „PV-Bench 23-24“ auf dem Mont-Soleil zielt darauf ab, die Leistung verschiedener Photovoltaik (PV)-Module zu vergleichen. Nach mehr als einem Jahr Testphase zeigen die Ergebnisse deutliche Unterschiede, doch die Qualität des Schweizer Moduls sticht heraus. Um diese Genauigkeit zu erreichen, wurde ein Testprotokoll entworfen, eine Methode zur Datenfilterung erarbeitet und ein Messgerät speziell von der Berner Fachhochschule (BFH) entwickelt.
Seit über dreißig Jahren produziert das Photovoltaikkraftwerk auf dem Mont-Soleil Strom. Ursprünglich sollte es die Machbarkeit der Solartechnologie beweisen. Heute weist die 32 Jahre alte Anlage eine Leistungsverschlechterung von weniger als 8 % auf und liegt damit weit über den damaligen Garantien. Ist diese Anlage heute noch relevant, da die meisten Photovoltaikmodule aus China kommen und die Technologie der 90er Jahre vom Markt verschwunden ist?
Um diese Frage zu beantworten, haben die Gesellschaft Mont-Soleil, der Espace découverte Énergie und die Berner Fachhochschule (BFH) das Pilotprojekt „PV Bench Mont-Soleil“ gestartet. Ziel des Projekts ist es, die Qualität von Solarmodulen in einem Umfeld zu bewerten, in dem die Kosten gesunken sind und die Frage nach ihrer Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit immer drängender wird.
Sorgfältig ausgewählte Panelmodelle
Im Rahmen des Projekts sollten 6 marktübliche PV-Modelle von 5 verschiedenen Herstellern getestet werden, die 3 konkurrierende Technologien abdecken:
- Jinko Solar, Tiger Neo, 430 W
- Meyer Burger, bifacial, 375 W
- Meyer Burger, weiss, 385 W
- Ja Solar, JAM60S20, 385 W
- 3S, MegaSlate II, 195 W
Die Auswahl umfasst Module aus China (Jinko Solar und Ja Solar), Deutschland (Meyer Burger) und der Schweiz (3S). Die Zellen verwenden die Technologien TOPCon (Jinko Solar), HJT (Meyer Burger) und PERC (Ja Solar und 3S).
Ein hochpräzises Testgerät
Um zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten, wurde eine Testtabelle konstruiert. Zusätzlich zu den Messungen, die mit Pyranometern gesammelt wurden, um die von einem PV-Modul erzeugte Leistung mit der Einstrahlung zu vergleichen, wurde von den BFh-Studenten in Zusammenarbeit mit dem PV-Labor der BFh ein spezielles Gerät entwickelt (siehe Foto 1). Dieses neue Gerät mit dem Namen „IV-Curve-Tracer IVCT“ funktioniert folgendermaßen: Jedes PV-Modul wird im Normalbetrieb an einen Mikro-Wechselrichter angeschlossen, wie bei einer Balkon-Solaranlage. Somit besteht PV-Bench also aus 30 Balkon-Solaranlagen, wodurch sichergestellt wird, dass sich die Module nicht gegenseitig beeinflussen. Jede Minute werden die Module vom Wechselrichter getrennt, damit der IVCT 100 Millisekunden lang die Leerlaufspannung, den Kurzschlussstrom und die Kennlinie der Module messen kann.

Foto von „IV-Curve Tracer IVCT“ – ein speziell für diese Forschung entwickeltes Messgerät

Beispiel einer Spannungs-Strom-Kurve, die mit dem Gerät „IV Curve Tracer IVCT“ gemessen wurde
Reduzieren Sie die Datenmenge, ohne an Genauigkeit zu verlieren
Eine statistische Analyse ermöglichte es, die Anzahl der gemessenen Punkte zu reduzieren, ohne die Genauigkeit der Ergebnisse zu beeinträchtigen. So wurde eine Dimensionsreduktion um den Faktor 100 vorgenommen, um „nur“ 100 Messpunkte pro Minute und PV-Modul zu verarbeiten.
Diese 100 Punkte bilden eine Kurve, die Strom und Spannung in Beziehung zueinander setzt. Sie ermöglichen es, die Leistung eines Solarmoduls zu bewerten. Aus der Messkurve werden relevante Punkte wie die maximale Leistung, die das Modul erzeugen kann, der Kurzschlussstrom und die Leerlaufspannung extrahiert. Schließlich wurde eine Degradationsfunktion verwendet, um die Verschlechterung der Modulleistung im Laufe der Zeit zu quantifizieren, indem verschiedene Variablen integriert wurden.
Langfristige Messungen unter realen Bedingungen
Eines der Ziele dieser Forschung ist es, genaue Langzeitmessungen unter realen Bedingungen zu verlässlich zu machen. Diese Messungen sind unerlässlich, um die Haltbarkeit und Effizienz von PV-Anlagen im Laufe der Zeit zu verstehen. Allerdings sind diese Messungen anfällig für verschiedene Arten von Fehlern, die ihre Zuverlässigkeit beeinträchtigen.
Um dem entgegenzuwirken, wurde eine Methode zur Datenfilterung parametrisiert und angewendet. Sie ermöglicht :
- Ausreißer und nicht repräsentative Daten eliminieren
- Reduzieren Sie das Messrauschen, um stabilere Ergebnisse zu erzielen.
- Identifizierung und Ausschluss von Effekten, die nicht mit der tatsächlichen Degradation der Platten zusammenhängen, wie z. B. Daten, die bei sehr geringer Bestrahlung erhoben wurden
Schließlich lassen sich aus den gesammelten und gefilterten Daten zahlreiche wissenschaftliche Schlussfolgerungen über PV-Module ziehen. So können die Leistung und der Wirkungsgrad sowie der interne Zustand der Module bewertet werden. Die Qualität und Genauigkeit der Daten ermöglicht es zum Beispiel, die Verschlechterung der Lötstellen der Verbindungsleisten zu messen, die die Solarzellen miteinander verbinden.
Ergebnisse und Schlussfolgerung
Obwohl nach einem Jahr Betrieb noch keine Schlussfolgerungen über die Lebensdauer der Module gezogen werden können, wurden erste Erkenntnisse gewonnen, die mit den Ergebnissen anderer Forschungsprojekte übereinstimmen:
- Der Trend zu „immer weniger Inhalt in der Verpackung“ zeigt sich auch in der Welt der PV-Module. Der Schweizer Hersteller 3S ist der einzige, der genau die versprochene Leistung erbringt, während die anderen Module eine Toleranzabweichung von 2-3 % aufweisen.
- Die bewährten PERC-Technologien von 3S und JA Solar zeigen die geringsten Leistungseinbußen. TOPConet HJT hingegen zeigen nach einem Jahr einen gewissen Leistungsabfall.
- Das Glas-Glas-Modul liefert eine stabilere Leistung als das Glas-Folien-Modul. Dieses Ergebnis ist nicht unerwartet: Die Glasrückseite bietet einen besseren Schutz als die herkömmliche Folie.
Schließlich offenbart PV-Bench eine Herausforderung: Die meisten der getesteten Produkte sind bereits nicht mehr auf dem Markt erhältlich. Die Ergebnisse sind daher nicht besonders repräsentativ für die Auswahl von Modulen in einem PV-Projekt. Sie erhöhen jedoch den Druck auf die Hersteller, qualitativ hochwertige Module zu produzieren. Und genau das ist eines der Hauptziele von PV-Bench: Produkte zu vergleichen, um die Qualität von PV-Anlagen zu verbessern.
Weitere Informationen über das Pilotprojekt PV Bench: www.pv-bench.ch
Dr. Christof Bucher, Professor für photovoltaische Systeme – Berner Fachhochschule
Laurent Raeber, Directeur Swiss Energypark et Société Mont-Soleil